
Forschungsprojekte mit Bezug zur Nachhaltigkeit
Hier sind Forschungsprojekte aufgeführt, die einen Bezug zur Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben und nach 2020 begonnen wurden.
Weitere Projekte mit Stichwort "nachhaltig" können auf den Forschungsseiten unter Forschungsprojektübersichtgefunden werden.
Die TiHo ist Mitglied im Transformationsverbund trafo agrar.
Dieser Verbund setzt sich zum Ziel "sich gemeinsam mit den Verbundpartnern pro-aktiv für die nachhaltige Entwicklung agrarischer Intensivregionen im Nordwesten, in Niedersachsen und Europa einzusetzen - basierend auf dem normativen Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) - in dem Bestreben, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Barrieren und Herausforderungen als Chancen und Perspektiven zu nutzen."
Produktionsstufenübergreifende Gesundheitsförderung in der Geflügelproduktion
Kreislaufschließung durch nachhaltiges Recycling von lignozellulosereichen organischen (Neben-) Produkten für die Insektenproduktion und die Herstellung von Heimtierfuttermitteln
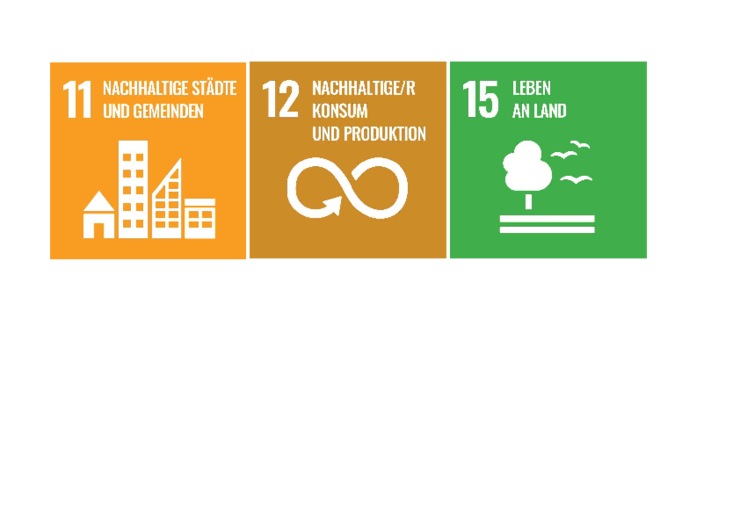
Closing the loop with sustainable recycling of lignocellulose rich organic (by-)products for insect development and pet food production
Laufzeit: Januar 2024 bis Dezember 2027
Drittmittelprojekt: Volkswagenstiftung
Kliniken/Institute:
Institut für Tierernährung
Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit
Projektdetails:
Eine potentiell flächendeckende Wiedervernässung der Moore zwecks Revitalisierung und CO2-Speicherung führt über die extensive Nutzung zum Anfall ligninreicher Primärbiomasse, die nicht effizient für die klassische Tierhaltung nutzbar ist. Diese Biomasse kann bisher maximal energetischen Zwecken dienen, was aber in Zukunft im Sinne einer ehrgeizigen Energiewende und Kreislaufwirtschaft nicht mehr zielführend ist. Im Rahmen dieses Projektes soll die Lignozellulosestruktur der organischen Rohstoffe technisch durch Vorbehandlungen aufgebrochen werden und die dann insgesamt besser verdauliche Biomasse anschließend für eine dezentrale Insektenproduktion genutzt werden. Modellhaft sollen Standard-Insektenlarven (schwarze Soldatenfliege) und Spezialitäten (Mehlwurm, Grillen etc.) aufgezogen werden. So sollen skalierbar hochwertige Rohstoffe für die Heimtierernährung oder perspektivisch neuartige Lebensmittel produziert werden.
Kooperationspartner:
Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., Quakenbrück
Dr. Kashif ur Rehman
Fütterung zur Reduktion von Treibhausgasmissionen und Energieverbräuchen - Untersuchungen von Futtermittelauswahl und Angebotsform zur Steigerung von Nachhaltigkeit, Tiergesundheit und Regionalität in der Fütterung von Masthähnchen
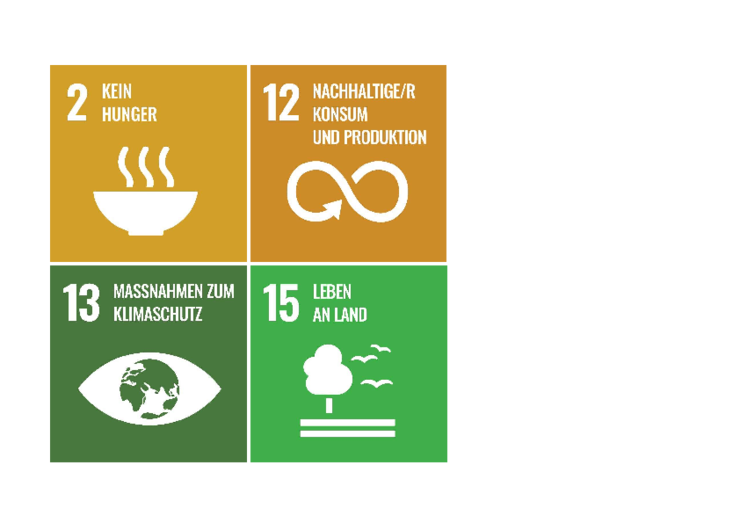
FUETURE
"Feeding for the reduction of greenhouse gas emissions and energy usage - Investigations of feed selection and feeding forms to increase sustainability, animal health, and regionalism in the Feeding of Broiler Chickens."
Projektverantwortliche: Prof. Dr. C. Visscher; Dr. V. Wilke; Dr. J. Gickel; TÄ A. Godglück
Laufzeit: Mai 2024 bis April 2027
Drittmittelprojekt: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Kliniken/Institute:
Institut für Tierernährung
Wissenschaft und Innovation für Nachhaltige Geflügelhaltung
Projektdetails:
Das Projekt "FUETURE" zielt darauf ab, regionale Futtermittelressourcen effizienter zu nutzen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz in der Masthähnchenproduktion zu verbessern. Es soll ein innovativer Ansatz entwickelt werden, der auf der Verwendung anpassungs- und widerstandsfähiger nachhaltig angebauter Futterpflanzen sowie bisher kaum genutzter heimischer Kulturen basiert. Durch die Reduktion des Imports nicht nachhaltig erzeugter Sojaprodukte aus Übersee soll die Nachhaltigkeit gestärkt werden. Das wissenschaftliche Ziel besteht darin, regionale Futterrationen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und Verfügbarkeit von Koprodukten zu entwickeln, um den ökologischen Fußabdruck des Hähnchenfleischs zu verringern. Durch innovative Futtermitteltechnologien und eine präzise Supplementation von Ergänzungsfuttermitteln sollen Umweltwirkungen signifikant reduziert werden. Das Projekt strebt eine Stärkung der nachhaltigeren regionalen Lebensmittelproduktion an und unterstützt die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie.
Kooperationspartner:
KWS Lochow GmbH, Technische Hochschule Bingen, IFF Braunschweig
Zukunft der Ernährung Niedersachsen - ZERN

Future of Food in Lower Saxony - ZERN
Laufzeit: April 2023 bis März 2028
Drittmittelprojekt: Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Projektkoordination:
Institut für Tierhygiene Tierschutz und Nutztierethologie
Projektdetails:
ZERN ist ein Forschungsverbund der Universität Göttingen, der Tierärztlichen Hochschule Hannover und des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück, mit dem die Transformation des Agrar- und Ernährungssystems in Niedersachsen unterstützt soll, das unter einem zunehmenden Anpassungsdruck steht. Aspekte wie Tierwohl und Nachhaltigkeit gilt es bei der landwirtschaftlichen Produktion künftig stärker zu berücksichtigen. Mit den Erkenntnissen aus dem Forschungsverbund soll die nachhaltige Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln möglich werden.
Kooperationspartner:
Georg-August-Universität Göttingen
Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL)
Optimierte Nährstoffversorgung von Zweinutzungshühnern - Angepasste Rationen, alternative Proteinquellen, Auswirkungen und Anpassungsmöglichkeiten

sLowFeedChickIns
Optimized nutrient supply of dual-purpose chickens - Adapted rations, alternative protein sources, effects and adjustment possibilities (short word: sLowFeedChickIns)
Laufzeit: September 2023 bis September 2027
Drittmittelprojekt: BLE
Kliniken/Institute:
Institut für Tierernährung
Projektdetails:
Gesamtziel des Vorhabens ist es das Potential des ökologischen Haltungssystems für Zweinutzungshühner unter den Gesichtspunkten ressourceneffiziente Rohstoffbeschaffung, Optimierung der Fütterung und Tierwohl auszuschöpfen.
Im Fokus steht hierbei die Integration von zwei verschiedenen Insektenarten (Acheta domesticus/n.n.) und Makroalgen (Palmaria palmata/n.n.) in die Fütterungsregime aktuell im Ökolandbau genutzter Gebrauchskreuzungen.
Kooperationspartner:
- Oekologische Tierzucht gGmbH
- Johann Heinrich von Thünen-Institut
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
- Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V.
- Bioland Beratung GmbH
Digitale Rückverfolgbarkeit und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette Schwein in der Region Oldenburger Münsterland - Transparency in Pig Production
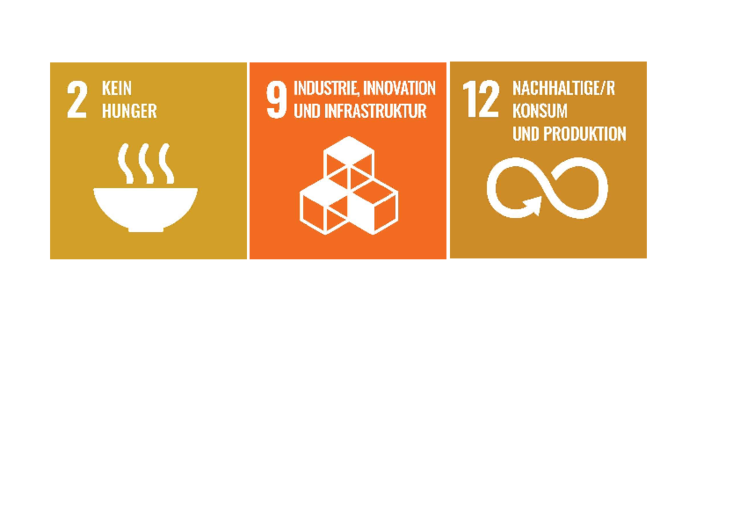
TiPP
Digital traceability and transparency along the pig value chain in the Oldenburg Münsterland region - Transparency in Pig Production (TiPP)
Laufzeit: Januar 2023 bis Dezember 2025
Drittmittelprojekt: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Kliniken/Institute:
Institut für Tierhygiene Tierschutz und Nutztierethologie
Projektdetails:
Die Zukunftsregion "TiPP" verfolgt das Ziel, die Transparenz und Rückverfolgbarkeit in einer regional etablierten Wertschöpfungskette Schwein über digitale Strategien from farm to fork zu optimieren. Im Zentrum der praxisnahen Erprobungen steht der bei Nutztieren gänzlich unerforschte Einsatz von Self Sovereign Identity (SSI) mit seinen Konzepten und verwendeten Technologien (DLT, Blockchain). Für die Erprobung und spätere Ableitung von Transparenz-Indices für Verbraucher werden Tier-, Betriebs- und Prozessdaten entlang der gesamten Wertschöpfungskette Schwein durch Teilprojekte erhoben, die u.a. die Transparenz-relevanten Bereiche Datenmanagement, Sensoreinsatz, Tiergesundheit, Tierwohl, Klimaeffizienz, Nachhaltigkeit und Verbraucherverhalten adressieren.
Kooperationspartner:
- Landwirtschaftskammer Niedersachsen
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- OFFIS e.V.
- Johann Heinrich von Thünen-Institut
- Georg-August-Universität Göttingen
Mikroplastik Analysen an Meeressäugetieren aus der Arktis

MiPaMar
Microplastic analyses on marine mammals from the Arctic (MiPaMar)
Laufzeit: November 2023 bis Oktober 2026
Drittmittelprojekt: Umweltbundesamt, 306.051 EUR
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Die Plastikverschmutzung ist mittlerweile weltweit bekannt und stellt ein allgegenwärtiges Problem für jedes Ökosystem dar. 2021 lag die jährliche Kunststoffproduktion bei 390,7 Millionen Tonnen. Man unterscheidet zwischen Makroplastik (> 5 mm), Mikroplastik (MP; < 5 mm) und Nanoplastik (im Nanometerbereich).
Diese Kunststoffpartikel gelangen über verschiedene Wege in die Meeresumwelt, z. B. über Abwässer, atmosphärischen Transport, Meeresströmungen, Deponien und Fischerei-aktivitäten. Einmal in der Umwelt, wird Makromüll in kleinere Partikel zerlegt, weil die Polymerstruktur durch Photodegradation (UV), Hydrolyse, mechanischen Abrieb, biologischen Abbau (Mikroorganismen) oder Biofouling (Besiedlung von Kunststoffen durch Mikroben) geschwächt wird.
Die Polargebiete galten lange als vom Menschen weitgehend unbeeinflusste Regionen der Erde. Auch wenn es sich um eine nicht stark besiedelte Region handelt, wurden in diesem Ökosystem in einer Vielzahl von Kompartimenten wie der Wassersäule, dem Schnee, dem Meereis und den Tiefseesedimenten MP nachgewiesen. Die Erhöhung der Temperatur im Zuge des Klimawandels und die damit verbundene Eisschmelze bringen diverse Probleme mit sich - neben dem Anstieg des Meeresspiegels, führt die zunehmende Abnahme des Meereises dazu, dass das Mikroplastik wieder freigesetzt wird, welches durch die Eisvorkommen bis dato gebunden war. Dieses ist nun "verfügbar" und gelangt in das sensible Ökosystem - die Folgen sind noch nicht abschätzbar. Das Vorkommen von Mikroplastik in der Arktis führt dazu, dass Arten der Polregion nun vermehrt einem anthropogen verursachten Problem konfrontiert sind - das Vorkommen von Meeresmüll bzw. Mikroplastik und seine Folgen. Dies beinhaltet auch arktische Völker, deren Nahrungsgrundlage ebenfalls das Fleisch- und Fettgewebe von Meeressäugetieren umfasst.
Ziel des Projektes ist es, valide Daten zur Mikroplastik- und assoziierte Schadstoffbelastung von Meeressäugetieren aus arktischen Gewässern zu erhalten und somit den Kenntnisstand in diesem sensiblen Lebensraum zu verbessern. Die erworbenen Kenntnisse sind der Grundstein für erforderliche, zukünftige Trendanalysen, die nötig sind, um ein effektives MP-Monitoring in arktischen Gewässern zu ermöglichen. Dabei werden die folgenden für die Arktis charakteristischen Arten untersucht: Schweinswale (Phocoena phocoena), Ringelrobbe (Pusa hispida), Kegelrobbe (Halichoerus grypus), Seehund (Phoca vitulina), Klappmütze (Cystophora cristata) Bartrobbe (Erignathus barbatus) und Eisbär (Ursus maritimus). Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Etablierung einer Methode zur Sichtbarmachung von MPs im Gewebe. Dazu werden Gewebestücke von Magen-Darm-Trakt präpariert und sowohl histologisch als auch mittels konfokalem Mikroskop untersucht. Mit Hilfe verschiedener Färbetechniken wird dann potentielles Mikroplastik im Gewebe identifiziert. Ein wichtiger Schritt, um die Transportwege vom Mikroplastik besser nachvollziehen zu können und Eintragspfade zu verifizieren.
Die Proben stammen von verschiedenen Kooperationspartnern wie zum Beispiel der Universität Island und dem norwegischem Polarinstitut. Die Schadstoffanalyse wird von der Universität Siena durchgeführt.
Tierwohl als Dimension von Nachhaltigkeit 2
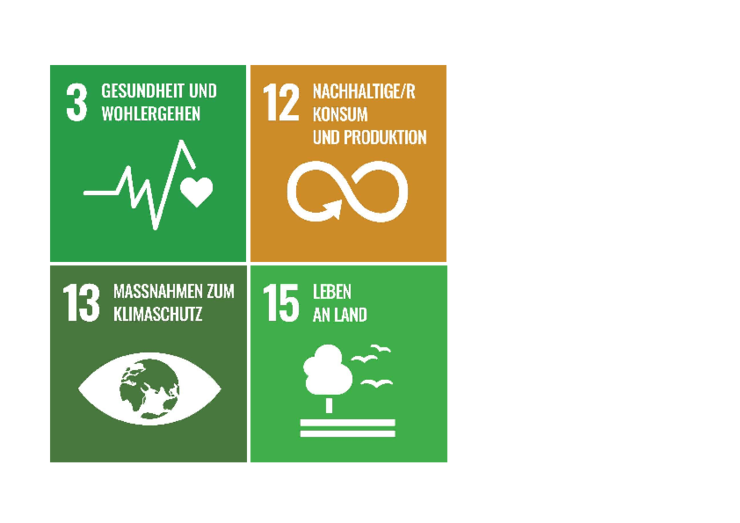
Animal welfare as a dimension of sustainability 2
Laufzeit: Mitte 2022 bis Dezember 2023
Drittmittelprojekt: Rentenbank
Kliniken/Institute:
Institut für Tierhygiene Tierschutz und Nutztierethologie
Projektdetails:
Ziel des Projektes ist es, Tierwohl als feste Größe in Nachhaltigkeitskonzepten zu integrieren. Dies geschieht auf konzeptioneller Ebene und anhand von Fallstudien zu ausgewählten Nutztierarten.
CoastalFutures-Zukunftsszenarien zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung mariner Räume - Teilprojekt I: Szenarien für marine Säugetiere

CoastalFutures-Scenarios to Promote Sustainable Futures of Contested Marine Areas - Subproject I: Scenarios for marine mammals
Laufzeit: Dezember 2021 bis November 2024
Drittmittelprojekt: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)/PTJ Jülich, 528.494 EUR
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Marine Säugetiere, wie Kegelrobbe, Seehund und Schweinswal, sind wichtige Topprädatoren im Ökosystem der Nord- und Ostsee. Alle Arten haben einen hohen Schutzstatus in Europa und reagieren sensibel auf Änderungen und Störungen in ihrer Umwelt. Sie gelten daher als wichtige Indikatoren für den Zustand von marinen Ökosystemen. Um diese Artengruppe in Ökosystemmodellen entsprechend zu berücksichtigen und auch Bewertungen sowie Managementmaßnahmen vorzunehmen, müssen sowohl die Ansprüche an ihr Habitat als auch die Einflüsse von anthropogenen Stressoren mit einbezogen werden.
Das Ziel dieses Projektes ist es, das Vorkommen der marinen Säugetiere im neuartigen skalenübergreifenden End-to-End (E2E) Modellsystem, welches in CoastalFutures interdisziplinär entwickelt wird, zu integrieren. Mit diesem Modellsystem schafft das Projekt eine virtuelle Umgebung zur Untersuchung von Auswirkungen der Klimaänderung und anthropogener Nutzungen auf Ökosysteme und Schlüsselarten sowie zur Testung unterschiedlicher Managementmaßnahmen, die gerade im Zusammenhang mit dem Schutz und Erhalt von marinen Säugetierpopulationen noch nicht bewertet sind.
Das Projekt verbessert die Vorhersage von zeitlichen und räumlichen Veränderungen im Vorkommen von marinen Säugetieren und entwickelt ein Verständnis für diejenigen Prozesse, die die interannuelle und saisonale Variabilität der Artenverteilung beeinflussen. Zudem werden bei der Modellentwicklung Interessenvertreter eingebunden, um aktuelle und potenzielle Nutzungsmuster zu bewerten und Managementmaßnahmen zu testen. Anthropogene Stressoren, wie z.B. die Auswirkungen des Offshore-Windenergie-ausbaus, werden durch Telemetriestudien an Seehunden untersucht, um über die Aufnahme und das Modellieren von Verhaltensreaktionen Rückschlüsse auf die Effekte von Lärmemissionen auf das Energiebudget zu ziehen. Dies ermöglicht eine multifaktorielle, umfassendere Bewertung des vom Menschen verursachten Unterwasserlärms. Die Nutzungsszenarien werden in Kombination mit Szenariensimulationen zu regionalen Auswirkungen des zukünftigen Klimawandels mit den Modellen zur Verteilung der marinen Säugetiere durchgeführt und mit dem End-to-End (E2E) Modellsystem gekoppelt.
Im Ergebnis generiert das Projekt dringend benötigtes Handlungswissen zur Umsetzung von politisch-gesellschaftlichen Zielvorgaben, etwa aus der EU Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, und ermöglicht die Evaluierung der Effektivität von Managementoptionen für das Schutzgut?marine Säugetiere? unter zukünftigen Klimabedingungen.
Kooperationspartner:
- Hereon Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH, Zentrum für Material- und Küstenforschung
- Prof. Corinna Schrum, Institut für Küstensysteme -Analyse und Modellierung
- IOW Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
- CAU-FTZ Universität Kiel, Forschungs- und Technologiezentrum Westküste
- TUBS Technische Universität Braunschweig, Leichtweiß-Institut für Wasserbau
- UHH Universität Hamburg, Institut für Meereskunde
- TI-SF/OF Thünen-Institut (TI für Seefischerei, TI für Ostseefischerei)
- LUH Leibniz Universität Hannover, Ludwig-Franzius-Institut
- AWI Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
- TUHH Technische Universität Hamburg, Institut für Wasserbau
- BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
- DWD Deutscher Wetterdienst
- BAW Bundesanstalt für Wasserbau
- BfN Bundesamt für Naturschutz
- SWIMWAY SWIMWAY Wattenmeer-Gruppe
CoastalFutures-2-Zukunftsszenarien zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung mariner Räume -Teilprojekt F: Szenarien für marine Säugetiere

CoastalFutures 2-Scenarios to Promote Sustainable Futures of Contested Marine Areas-Subproject F: Scenarios for marine mammals
Laufzeit: Dezember 2024 bis November 2027
Drittmittelprojekt: Bundesministerium für Bildung und Forschung über Projektträger Jülich/Forschungszentrum Jülich GmbH, Rostock
Projektleitung:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Der Lebensraum mariner Säugetiere ist stark durch anthropogene Nutzungen in Nord- und Ostsee geprägt. Marine Säugetiere reagieren empfindlich auf Stressoren, wie den Schiffsverkehr, den Ausbau der Offshore-Windenergie, die Verschmutzung oder die Fischerei. Diese Aktivitäten können zu einer Degradierung des Lebensraums für Meeressäuger führen, da es häufig zu Habitatverlusten oder Zerschneidungen kommt.
Das in der ersten Phase von CoastalFutures entwickelte interdisziplinäre und skalenübergreifende End-to-End (E2E) Modellsystem wird in der zweiten Phase erweitert, um das Vorkommen mariner Säugetiere unter verschiedenen Zukunftsszenarien zu modellieren. Dieses neuartige Werkzeug bietet nun die Möglichkeit, die Auswirkungen des Klimawandels und anthropogener Aktivitäten auf Indikatorarten durch die Generierung einer virtuellen Umgebung zu untersuchen. So können in Phase II erstmals Simulationen zur Wirksamkeit verschiedener Managementmaßnahmen zum Schutz und Erhalt von Meeressäugerpopulationen durchgeführt und damit Handlungswissen zur Implementierung politischer Entscheidungen bereitgestellt werden. Mittels multifaktorieller Bewertung wird der Einfluss des Unterwasserlärms auf Seehunde infolge des Ausbaus der Offshore-Windfarmen (?-WFs) auf Populationsniveau abgeschätzt. Hierbei werden Tierbewegungsmodelle um Aspekte der Tierphysiologie erweitert, sodass Effekte auf das Energiebudget integriert werden können, während zusätzlich die Auswirkungen weiterer Stressoren und Managementmaßnahmen unter Berücksichtigung zukünftiger Klimabedingungen betrachtet werden. Zudem werden potenzielle Auswirkungen, wie die Rolle von OWFs als künstliche Riffe und die Lärmauswirkungen auf marine Säugetiere, analysiert und bewertet, um negative und positive Effekte zu erforschen. Dies wiederum führt zu einer quantitativen Einschätzung der Nahrungs und Lebensgrundlage für marine Säugetiere sowie der Belastung durch Stressoren in den Meeresschutzgebieten.
Kooperationspartner:
- Helmholtz-Zentrum Hereon, Institute of Coastal Systems - Analysis and Modeling
- Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde
- Technische Universität Braunschweig, Leichtweiß-Institute for Hydraulic Engineering and Water Resources
- Thünen-Institut (TI für Seefischerei, TI für Ostseefischerei)
- Leibniz Universität Hannover, Ludwig-Franzius-Institut
- Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven
- Technische Universität Hamburg, Institute of River and Coastal Engineering
Assoziierte Partner:
- Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
- Deutscher Wetterdienst
- Bundesanstalt für Wasserbau
- Bundesamt für Naturschutz
Water Safe
Watersafe
Laufzeit: März 2021 bis Dezember 2022
Drittmittelprojekt: Projektförderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ANBest-ELER 2021, Europäischen Innovationspartnerschaft "Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft" (EIP Agri)
Kliniken/Institute:
Außenstelle für Epidemiologie (Bakum)
Projektdetails:
Suboptimale Wasserverfügbarkeit, -qualität und Tränkwasserleitungshygiene in der Schweinehaltung führen zu Problemen bezüglich Tierwohl und Tiergesundheit. Eine unzureichende Wasseraufnahme aufgrund technischer Mängel, geringer Schmackhaftigkeit durch z.B. Biofilmbildung in den Leitungen oder eines restriktiven Wasserangebotes stellen einen massiven Stressor für die Tiere dar und können zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen, die anderen Krankheiten Vorschub leisten (z.B. Ohr- und Schwanzveränderungen, Durchfall).
In diesem Projekt soll ein neues Tränkwasserleitungsreinigungskonzept für Ferkelaufzuchtbetriebe in zwei Aufzuchtställen etabliert und für die Praxis getestet werden. Das System, das in einem Gemeinschaftsprojekt entwickelt und unter Laborbedingungen erprobt wurde, soll dazu genutzt werden, mit Belägen behaftete Wasserleitungen zu reinigen, Salmonellenreservoire in den Leitungen zu zerstören und eine mögliche Endotoxinbelastung des Tränkwassers soweit zu reduzieren, dass Ohr- und Schwanzveränderungen verschwinden, sofern sie mit Endotoxinen im Zusammenhang stehen. Nach technischen, chemischen und mikrobiologischen Analysen, sowie Untersuchungen der Ferkel wird eine Tränkwasserleitungsreinigung auf den Betrieben durchgeführt. Zum Einsatz kommen eine neu entwickelte, mobile Spüleinrichtung und eine neue Substanz aus Weinsäure und katalytischen Additiven, die eine hohe Wirksamkeit gegen Biofilme aufweist und auch die Erbsubstanz von Erregern zerstört. Die Effekte des Konzeptes werden in drei Durchgängen gemessen und bewertet.
Kooperationspartner:
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Aumann Hygienetechnik
- ConVet GmbH&Co. KG
Phosphor-angepasste Futtermittel am Beispiel Kleie

PhANG
Phosphorus-adapted feed using bran as an example
Laufzeit: Juli 2020 bis Juni 2023
Drittmittelprojekt: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), 145.203 EUR
Kliniken/Institute:
Institut für Tierernährung
Projektdetails:
Eine große Herausforderung für die heimische Tierproduktion ist eine immer weitergehende Reduktion der damit einhergehenden unerwünschten Umwelteffekte. Diese gilt insbesondere bezüglich des P-Eintrags durch Düngung / Gülle in die natürliche Umwelt und der daraus resultierenden potenziellen Eutrophierung der Grund- und Oberflächenwässer. Deshalb ist bei der Nutztierfütterung eine gerade noch bedarfsdeckende P-Versorgung anzustreben, da jeder P-Überschuss im Tierfutter über die Gülle in die natürliche Umwelt eingetragen wird. Vor diesem Hintergrund stellt ein bedarfsgerechter P-Gehalt in einem bestimmten Futtermittel ein neues "Qualitätsmerkmal" dar, auf das hin die heute angebotenen Mischfutter optimiert werden.
Für eine entsprechende P-Optimierung im Tierfutter durch eine P-Abtrennung und/oder Umwandlung in tierverfügbare P-Formen wird hier exemplarisch die Kleie als ein "klassisches" Futtermittel (1,5 Mt/a in Deutschland) untersucht. Dazu sollen mithilfe unterschiedlicher biokatalytischer und/oder mechanisch-chemischer Verfahren technisch darstellbare Prozesse für die Futtermittel-Konditionierung entwickelt und diese im Rahmen integrierter Bioraffinerie-Gesamtkonzepte technisch sowie ökonomisch und ökologisch bewertet werden.
Kooperationspartner:
- Institut für Technische Biokatalyse der TUHH,
- Institut für Biotechnologie der RWTH,
- sowie mehrere assoziierte Partner aus der Industrie
Entwicklung betriebs- und verfahrenstechnischer Lösungen für eine nachhaltige, Stickstoff-effiziente und tiergerechte Indoor-Garnelenproduktion auf Basis der Biofloc Technologie (BFT)
KoMARe II
KoMARe II: Development of operational and process engineering solutions for sustainable, nitrogen-efficient and animal-friendly indoor shrimp production based on Biofloc Technology (BFT)
Laufzeit: August 2019 bis März 2022
Drittmittelprojekt: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Kliniken/Institute:
Fachgebiet Fischkrankheiten Institut für Parasitologie
Projektdetails:
Die Aufzucht von aquatischen Organismen zur Gewinnung von Lebensmitteln in Kreislaufanlagen in Gebäuden an Land ist aus Gründen des Umweltschutzes (Vermeiden von Nährstoff-Eintrag in Gewässer) und Sicherstellung der Wasserversorgung der Aquakultur angesichts eines stark schwankenden Wasserangebots durch den Klimawandel dringend geboten. Allerdings ist die Technologie hinsichtlich Nachhaltigkeit und Tierwohl noch nicht ausgereift und daher verbesserungswürdig. Die relativ junge und in Europa noch wenig realisierte Biofloc-Technologie (BFT) bietet nach dem derzeitigen internationalen Stand der Kenntnis für die Zielstellung einer nachhaltigen Aquakultur ein bedeutendes Potenzial, das es zu entwickeln gilt. Das Potenzial von BFT-Systemen zur Umweltentlastung bei der Aufzucht von tropischen Riesengarnelen (Litopenaeus vannamei)besteht im Vergleich zu herkömmlichen Kreislaufanlagen darin, dass aus Detritus, Bakterienkolonien und kleinen Wirbellosen bestehende Bioflocken von Garnelen als Nahrung aufgenommen werden können und so zu einer Re-zirkulation von Nährstoffen (Stickstoff, Phosphor, organische Reststoffe), verbunden mit einem reduzierten Ressourceneinsatz (Wasser, Futtermittel), zu einer geringeren Freisetzung von eutrophierenden Stickstoff- und Phosphorverbindungen und letztlich zu einer erhöhten Biosicherheit und Produktivität bei einem niedrigeren spezifischen Energieverbrauch führen. Darüber hinaus kann die Verwendung von Bioflocken, die in ihrer Zusammensetzung der natürlichen Nahrung von Garnelen entsprechen, zu einer Verbesserung des Tierwohls durch verbesserte Fütterung führen.
Kooperationspartner:
Polyplan GmbH, Bremen
Insektenzucht vorangebracht. Förderung der nachhaltigen Insektenzucht und -haltbarmachung in Kambodscha und Thailand
IFNext
IFNEXT: BRINGING INSECT FARMING TO THE NEXT LEVEL - PROMOTING SUSTAINABLE INSECT FARMING AND PRESERVING IN CAMBODIA AND THAILAND TO INCREASE SHELF LIFE AND OBTAIN INNOVATIVE FOODSTUFFS BASED ON LOCAL RESOURCES IN ORDER TO COUNTERACT MALNUTRITION, PARTICULARLY OF MOTHERS AND CHILDREN
Laufzeit: Februar 2019 bis Dezember 2022
Drittmittelprojekt: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Kliniken/Institute:
Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit
Projektdetails:
Thailand und Kambodscha sind beide von Unterernährung bei Kindern und Müttern betroffen, sei es durch die schiere Menge von Fällen (Thailand), sei es durch den hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung (Kambodscha). Wenngleich der Konsum von Insekten (Entomophagie) in diesen Ländern eine langjährige Tradition hat, bezieht sich diese Tradition auf das Fangen von freilebenden Insekten und die darauffolgende Zubereitung und Verzehr dieser frischen bzw. tiefgekühlten Insekten. Wenn einerseits Speiseinsekten eine größere Rolle in der Ernährung der Menschheit spielen sollen, so wird eine Zucht anstelle von Wildfängen notwendig sein. Diese Techniken werden bereits in einigen Gegenden von Thailand und Kambodscha praktiziert und haben das Potential, als "Mini-Livestock" von Familien genutzt zu werden, denn viele Arten lassen sich nachhaltig auf Nebenerzeugnissen und mit weniger ökologischen Einschnitten als herkömmliche Nutztiere züchten. Andererseits ermöglicht die Insektenzucht Überschüsse, weswegen Techniken der Haltbarmachung notwendig werden, um mittels Verlängerung der Haltbarkeit die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Diese neuartigen Erzeugnisse können für die Familie produziert oder auf lokalen Märkten verkauft werden, um ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften.
IFNext beschäftigt sich mit diesen Notwendigkeiten. Die grundsätzliche Zielsetzung ist die nachhaltige Erzeugung von Insekten zum Selbstverzehr bzw. die Herstellung von Erzeugnissen, die auf dem Markt verkauft werden können und die Erwartungshaltung von Züchtern und Verbrauchern gleichermaßen erfüllen.
Kooperationspartner:
- Dr. Rachakris Lertpatarakomol, MUT: Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
- Dr. Keo Sath, RUA: Faculty of Veterinary Medicine, Royal University of Agriculture (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម)
- Dr. Chhay Ty, LDC: Centre for Livestock and Agricultural Development (មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ និងកសិកម្ម)
- Dr. Jamlong Mitchaothai, KMITL: Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut?s Institute of Technology Ladkrabang (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Die Rückkehr des eurasischen Otters in Schleswig-Holstein - Untersuchungen zur Ökologie, sowie zum fischereiwirtschaftlichen und artenschutzrechtlichen Konfliktpotential

Die Rückkehr des eurasischen Otters in Schleswig-Holstein - Untersuchungen zur Ökologie, sowie zum fischereiwirtschaftlichen und artenschutzrechtlichen Konfliktpotential
Project increase/extension-The return of the Eurasian Otter in Schleswig-Holstein - Investigations on the ecology, potential conflicts with fisheries management and conservation
Projektverantwortliche: Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert; Dr. Kai Sören Lehmann; Ilka Alina Fischer; Dr. Filipa Paiva-Antunes; Dr. Joy Boyi
Laufzeit: Mai 2024 bis Dezember 2025
Drittmittelprojekt: Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Der Eurasische Fischotter (Lutra lutra) breitet sich in allen Landesteilen Schleswig-Holsteins (SH) zunehmend wieder aus. Der vorwiegend aquatisch lebende Otter ist hauptsächlich in Fließgewässern und Seen, aber regional auch in Küstengewässern anzutreffen. Otter fressen hauptsächlich Fisch, nutzen als sog. Generalisten aber auch Amphibien, Vögel, Krebs- und Säugetiere oder auch Insekten. Der Rückgang von bestimmten Fischarten in Fließgewässern wird stellenweise dem Fischotter zugerechnet. Mit zunehmender Otterpopulation verschärfen sich sowohl national, als auch international die Fronten im Interessenskonflikt zwischen Teichwirtschaft/Fischerei und Otterschutz. Daher soll eine umfassende Abschätzung des Konfliktpotentials zwischen der Rückkehr des eurasischen Fischotters und der Teichwirtschaft, Binnenfischerei sowie anderer Artenschutzprojekte in SH erfolgen. Diese beinhaltet folgende, vergleichende Untersuchungen auf Fischzuchtanlagen, in natürlichem Otterhabitat und in Laichgewässern bedrohter Salmoniden:
-Einsatz von Wildkameras zur Einschätzung der lokalen Vorkommenshäufigkeit von Fischottern
-Nahrungsanalysen zur Beurteilung des Beutespektrums der Fischotter
-Individuenbestimmung (Genetisches Fingerprinting) von Fischottern anhand von Losung
-Evaluierung eines möglichen Zielartenkonflikts zwischen Fischottern und Salmoniden
-Abschätzung von akustischen Vergrämungsmaßnahmen von Fischottern auf Fischzuchtanlagen
-Bestimmung von Reproduktionsparametern zur Beurteilung der Populationsgesundheit der Fischotter anhand von Totfunden
- Entwicklung einer Besenderungs-Methode für Fischotter
CREATE-2: Entwicklung von Indikatoren zur Gesundheit bei Meeressäugern und ihre Weiterentwicklung zur Bewertung anthropogener Einflüsse
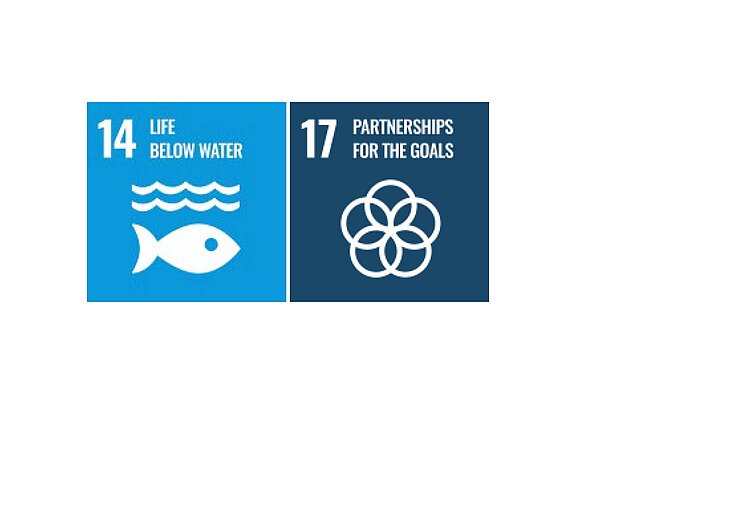
CREATE-2: Entwicklung von Indikatoren zur Gesundheit bei Meeressäugern und ihre Weiterentwicklung zur Bewertung anthropogener Einflüsse
CREATE-2: Development of indicator pathogens in marine mammals to a further development of assessment of anthropogenic effects
Projektverantwortliche: Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert; Dr. Stephanie Groß ; Dr. Andreas Ruser
Laufzeit: Dezember 2024 bis November 2027
Drittmittelprojekt: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)/PTJ Jülich
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
In Phase II des Vorhabens CREATE ist das Ziel des Teilprojektes der Stiftung Tierärztliche Hlochschule Hlannover weiterhin die Identifizierung und Etablierung von Indikatoren für die Gesundheit heimischer Meeressäuger, um die Einflüsse durch zunehmende anthropogene Aktivitäten auf Meeressäuger und das marine Ökosystem bewerten und frühzeitig erkennen zu können. Hierfür werden aus ca. drei Jahrzehnten vorliegende Gesundheitsdaten, sowie während der Projektlaufzeit neu erhobene Daten von heimischen Meeressäugern aus der deutschen Nord- und Ostsee analysiert. Die in Phase I gewonnenen Erkenntnisse zum räumlichen und zeitlichen Vorkommen von Bakterien und Viren, sollen in Phase II für weiterreichende Untersuchungen genutzt werden. Dabei soll eine mögliche Interaktion zwischen dem Auftreten der pathogenen Bakterien und Viren und anderen Infektionen, wie bakteriellen/viralen Koinfektionen oder einem Parasitenbefall, untersucht werden. Auch soll analysiert werden, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den ermittelten Erkrankungs- und Todesursachen und dem Auftreten bestimmter Pathogene besteht. In diesem Zusammenhang sind Faktoren, die eine Relevanz für die gesamte Population haben von besonderem Interesse. Über den zeitlichen Verlauf der Daten kann beurteilt werden, ob es Veränderungen in der Belastung von Meeressäugern über die letzten 30 Jahre gegeben hat. Abschließend sollen die analysierten Daten auf ihre Indikatoreignung hin evaluiert werden, insbesondere im Hinblick auf anthropogene Effekte auf Meeressäugerpopulationen. Die Identifikation solcher Indikatoren würde langfristige Monitoringstrategien ermöglichen, die Entwicklung effektiver Managementmaßnahmen fördern und auch in internationale Abkommen, wie HELCOM und OSPAR, einfließen. Zudem werden die im Projekt erarbeitete Daten genutzt, um verschiedene Wissensformate für Stakeholder zu erstellen und damit die gewonnenen Erkenntnisse auch an die breite Öffentlichkeit zu vermitteln.
Kooperationspartner:
- Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven inklusive Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität an der Universität Oldenburg
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Christian-Albrechts-Universität, Kiel
- GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
- Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen
- Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
- Leibniz-Zentrum f. Mar. Tropenforschung Bremen
DEMASK-Entwicklung und Bewertung von Lärmschutzstrategien zur Gesunderhaltung der Nordsee

DEMASK-Entwicklung und Bewertung von Lärmschutzstrategien zur Gesunderhaltung der Nordsee
DEMASK-Development and evaluation of noise management strategies to keep the North Sea healthy
Projektverantwortliche: Prof. Prof h. c. Dr. Ursula Siebert; Dr. Joseph Schnitzler
Laufzeit: Januar 2024 bis Dezember 2026
Drittmittelprojekt: Interreg VI-B Norseeprogramm EFRE (Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - EFRE) Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Hannover Mittel des Bundes
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Die Nordsee ist eines der am stärksten befahrenen Schifffahrtsgebiete. Um die Klimaziele der EU zu erreichen, ist in der Nordsee ein massiver Ausbau von Windparks geplant. Die Nordsee ist auch ein wertvoller Lebensraum für viele Arten, die durch zukünftige maritime Entwicklungen bedroht sind. Dazu gehört auch die Gefahr der Lärmbelästigung. Ziel von DEMASK ist es, Entscheidungsträger im maritimen Bereich, Raumplaner und Interessenvertreter aus der Industrie zu ermutigen, sich mit dem Thema Unterwasserlärm auseinanderzusetzen, indem sie gemeinsam Szenarien für die Zukunft der Nordsee planen, die Werkzeuge und das Wissen zur Bewertung von Lärmminderungsszenarien verbessern und strategische Prioritäten setzen, die zu einer gut verwalteten Lärmlandschaft führen.
DEMASK besteht aus drei Arbeitsgruppen. Das Kernstück (WP1) ist der gemeinsame Szenarienplanungsprozess. WP1 stützt sich auf die Beteiligung von Interessenvertretern und wurde speziell entwickelt, um die Übernahme der strategischen politischen Prioritäten für die Lärmminderung zu maximieren. Es werden die wichtigsten politischen Szenarien zur Lärmminderung definiert und bewertet. WP2 konzentriert sich auf die Vorhersage der zukünftigen Lärmsituation. Schließlich wird WP3 für die Nordsee Risikobewertungen für die Biodiversität für alternative Handlungsszenarien durchführen. Im Rahmen von Pilotprojekten werden die Lärmszenarien für diese alternativen Szenarien im Vergleich zur Ausgangssituation prognostiziert und diese Lärmszenarien verwendet, um die Auswirkungen von Lärm und die damit verbundenen Risiken für Indikatorarten zu bewerten. Die Risiken werden auf der Grundlage der Empfindlichkeit, der Verbreitung, des Lebensraums und der Exposition bewertet, wenn die Schwellenwerte für das Auftreten biologisch signifikanter negativer Auswirkungen (LOBE) auf regionaler Ebene überschritten werden. Dieses Arbeitspaket wird vom ITAW geleitet.
Kooperationspartner:
- Projektkoordination, Rijkswaterstaat (RWS), Ministry of Infastructure and Water Management, Utrecht
- Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH), Hamburg
- TNO research, Den Haag
- IVL Swedish Environmental Research Institute, Kristineberg
- Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS), Brüssel
- North Sea Foundation, Utrecht
- Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende
- JASCO Applied Sciences
DIAPHONIA: Diagnostischer Rahmen zur Bewertung und Vorhersage der Auswirkungen von Unterwasserlärm auf Meeresarten
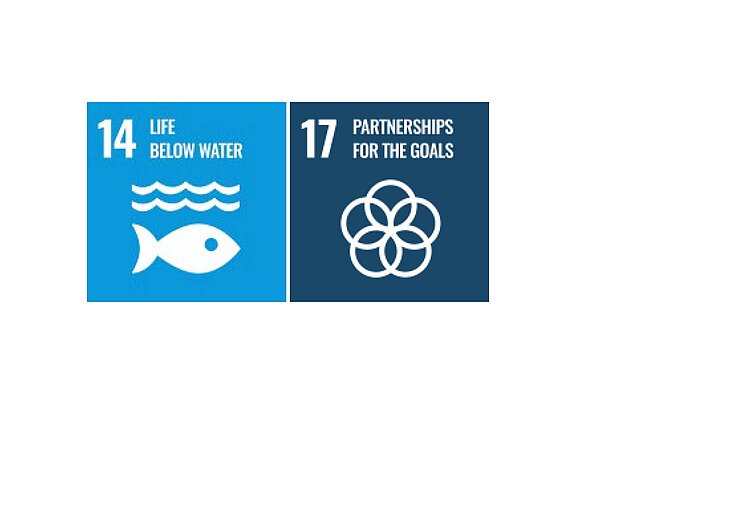
DIAPHONIA: Diagnostischer Rahmen zur Bewertung und Vorhersage der Auswirkungen von Unterwasserlärm auf Meeresarten
DIAPHONIA: DIagnostic framework to Assess and Predict tHe impact Of underwater NoIse on mArine species
Projektverantwortliche: Prof. Prof. h.c. Dr. Ursula Siebert; Dr. Maria Morell; Laura Rojas; Dr. Joy Boyi; Dr. Andreas Ruser
Laufzeit: Januar 2023 bis Dezember 2025
Drittmittelprojekt: BMBF - JIPOceans MARE:N-Meeres- und Polarforschung im Förderbereich: Meeresforschung, 399.994 EUR
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Es wurde nachgewiesen, dass die Meeresumwelt durch Lärmbelästigung durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wird. Die Schwierigkeit, klinische und pathologische Analysen an lebenden Organismen in der Meeresumwelt durchzuführen, und die große Vielfalt an Lärmbelästigungsquellen bedingen eine große
Ungewissheit hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der Auswirkungen, die Lärmbelästigung auf die Meeresfauna hat. Trotz der wachsenden Literatur zu diesen Themen gibt es immer noch relevante Lücken und einen Mangel an Multidisziplinarität bei Untersuchungen akuter und langfristiger Expositionen, sowohl bei einzelnen Tieren als auch bei Populationen. DIAPHONIA vereint Wissenschaftler um die verschiedenen Auswirkungen von Unterwasserlärm auf Meeresorganismen des Nahrungsnetzes, einschließlich wirbelloser und kommerzieller Arten, zu bewerten und sich dabei auf europäische Becken zu konzentrieren. Arbeitspaket 1 (AP1) wird einen möglichen diagnostischen Fingerabdruck entwickeln, der aus mehreren Gewebemarkern besteht, die molekulare, metabolomische und mikroskopische Techniken beinhalten, um funktionelle und morphologische Veränderungen in den akustischen Signalwegen von Wirbellosen, Fischen und Meeressäugern zu identifizieren. AP2 wird die Beziehung zwischen Verhaltens- und zellulären/molekularen/organischen Effekten sowohl kurz- als auch langfristiger Lärmexposition bei Fischen aus verschiedenen europäischen Meeresbecken untersuchen. WP3 wird einen Einblick in die Morpho-Funktionalität des peripheren Hörapparats bei Meeressäugern und seine Rolle bei der Definition der akustischen Empfindlichkeit des Tieres gewinnen, indem es einen standardisierten Arbeitsablauf für die Wellenausbreitung in den zugehörigen Geweben entwickelt. Alle erhaltenen Informationen und Daten werden mit relevanten Interessengruppen und politischen Entscheidungsträgern diskutiert, um sie an einen multidisziplinären und evidenzbasierten Ansatz an die bestehenden Leitlinien anzupassen
Kooperationspartner:
- Projektkoordination: Prof. Sandro Mazzariol
- UNIPD - Università degli Studi di Padova, Italy
- UPC- Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
- NTNU- Norway
LIFE CIBBRiNA - Coordinated Development and Implementation of Best Practice in Bycatch Reduction in the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Regions

Life CIBBRiNA - Coordinated Development and Implementation of Best Practice in Bycatch Reduction in the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Regions
Life CIBBRiNA - Coordinated Development and Implementation of Best Practice in Bycatch Reduction in the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Regions
Projektverantwortliche: Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert; Robabe Ahmadi
Laufzeit: September 2023 bis August 2029
Drittmittelprojekt: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) , 275.552 EUR
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Unbeabsichtigter Beifang in Fischereinetzen stellt weltweit eine erhebliche Bedrohung für Meerestiere dar, insbesondere für gefährdete, bedrohte und geschützte Arten, darunter Meeressäuger, Seevögel, Schildkröten und Hai- oder Rochenartige. Bislang waren die Bemühungen, den Beifang solcher Arten zu minimieren, kaum erfolgreich. LIFE CIBBRiNA ist ein internationales und sektorenübergreifendes Projekt, bei dem Forschungseinrichtungen, Umweltbehörden, die Fischereiwirtschaft und Nichtregierungsorganisationen aus 13 europäischen Ländern zusammenarbeiten, um Strategien zur Verringerung des Beifangs von gefährdeten, bedrohten und geschützten Arten in der Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeer zu entwickeln und ihre Umsetzung zu fördern. Im Rahmen von LIFE CIBBRiNA wird das ITAW Methoden für ein Monitoring und die Datensammlung zu Beifang erarbeiten. Dabei wird die Beifanginzidenz durch pathologische Untersuchungen gestrandeter Tiere ermittelt. Mit Hilfe von Driftmodellen für Kadaver können Beifang-Hotspots identifiziert werden, und eine Datenbank wird entwickelt, um Strandungsdaten zu sammeln und eine zeitlich-räumliche Auswertung der Daten zu ermöglichen. Darüber hinaus arbeitet das ITAW an der Vermittlung der Projektergebnisse an Interessengruppen (einschließlich der Entwicklung von Forschungsboxen als Unterrichtsmaterial für Schulen), der Vernetzung mit anderen Projekten und der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse von LIFE CIBBRiNA.
PURE WIND: Einfluss von Schall auf Meeresökosysteme durch Offshore-Windenergieerzeugung

PURE WIND: Einfluss von Schall auf Meeresökosysteme durch Offshore-Windenergieerzeugung
PURE WIND: Impact of sound on marine ecosystems from offshore wind energy generation
Projektverantwortliche: Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert; Dr. Joseph Schnitzler; Nina Maurer; Dr. Tobias Schaffeld
Laufzeit: Januar 2023 bis Dezember 2025
Drittmittelprojekt: BMBF - JIPOceans MARE:N-Meeres- und Polarforschung im Förderbereich:Meeresforschung, 394.621 EUR
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Geräusche von Offshore-Windparks (OWF) gehören zu den Hauptverursachern anthropogenen Lärms in der Meeresumwelt. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um mögliche Auswirkungen von Lärm zu verstehen, die sich aus den Entwicklungsstadien des OWP-Lebenszyklus ergeben. Trotz 30 Jahren OWP-Betrieb in EU-Gewässern ist unser Verständnis der Auswirkungen in der Betriebsphase auf Meeresökosysteme begrenzt. In diesem Konsortium wollen wir diese Lücke schließen, indem wir unser Wissen über den abgestrahlten Lärm und die biologischen Folgen dieser Vorgänge erweitern und sie in einen angemessenen regulatorischen Kontext stellen, einschließlich Bestimmungen für Empfehlungen zur adaptiven Minderung. Von der Quellen- und Medienseite aus werden wir die wichtigsten Merkmale des abgestrahlten Lärms von festen und schwimmenden OWPs quantifizieren, um das Verständnis zu verbessern und die kumulative Wirkung von Clustern auf abgestrahlten Lärm zu simulieren, was uns hilft, sensible Lebensräume in beckenübergreifenden Klanglandschaften zu identifizieren. Aus biologischer Sicht werden wir die räumliche und qualitative Nutzung von OWF in Betrieb durch Top-Prädatoren identifizieren und die Auswirkungen von OWF-Lärm auf das Verhalten von Zooplankton untersuchen. Diese Bemühungen werden unser Wissen über die akuten und kumulativen Auswirkungen von OWF-Betriebslärmin pelagischen Nahrungsnetzen erweitern. Durch die Harmonisierung und Kombination dieser beiden Seiten werden wir Wissen und Werkzeuge zur Integration aller Aspekte der Lärmerzeugung und -ausbreitung aus dem OWP-Betrieb entwickeln. Dies erleichtert die Bewertung des geplanten OWP-Ausbaus für Meeresraumplanung und Umweltauswirkungen. Schließlich werden wir Wissen und bewährte Verfahren aus EU- und internationalen Erfahrungen mit festen Offshore-Windanlagen synthetisieren und diese in die Entwicklung von Politik, Minderung und Regulierung für den schwimmenden OWP im nationalen, EU- und internationalen Rahmen übertragen.
SATURN - Solutions At Underwater Radiated Noise

SATURN - Solutions At Underwater Radiated Noise
SATURN - Solutions At Underwater Radiated Noise
Projektverantwortliche: Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert; Dr. Joseph Schnitzler
Laufzeit: Februar 2021 bis Januar 2025
Drittmittelprojekt: Europäische Union
Kliniken/Institute:
Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (Büsum)
Projektdetails:
Es ist allgemein anerkannt, dass Lärm, der durch die Schifffahrt und andere menschliche Aktivitäten in die Unterwasserwelt gelangt, aquatische Tiere stören und schädigen kann. Studien zeigten bereits diese Störungseffekte während andere Forschungen Möglichkeiten vorgeschlagen haben, wie einige der Geräusche die durch die Schifffahrt entstehen zu reduzieren sind. Es gibt jedoch noch Wissens- und Verständnislücken darüber, wie sich Unterwasserschall auf einzelne Tiere und ganze Populationen auswirken kann.
Das soll sich nun mit dem SATURN-Konsortium ändern, welches erstmals führende europäische Experten im Bereich Bioakustik, Tiermedizin, Populationsbiologie, dazu Schiffsbau und Ingenieurwesen in einem EU-finanzierten Projekt zusammenbrigt. Zu den Schlüsselfragen gehören:
- die Identifizierung von Geräuschen, die für aquatische Arten am schädlichsten sind und wie sie erzeugt und verbreitet werden;
- Welche kurzfristigen und kumulativen langfristigen negativen Auswirkungen hat Lärm von Schiffen und Booten auf aquatische Arten in Flüssen und im Meer;
- Welche sind die vielversprechendsten Optionen zur Messung und Reduzierung der negativen Auswirkungen von Schiffslärm, die auf aktuelle und zukünftige Schiffe angewendet werden können.
Das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der TiHo übernimmt in diesem Konsortium die Leitung des Biologischen Arbeitsbereiches, welches den Einfluss von Unterwasserschall auf das Verhalten, der Gesundheit und den Energiehaushalt von Wasserorganismen untersucht. Ein weiterer wichtiger Aspekt der von dem ITAW unterstützt wird ist die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation.
Produktionsstufenübergreifende Gesundheitsförderung in der Geflügelproduktion

Produktionsstufenübergreifende Gesundheitsförderung in der Geflügelproduktion - Minimierung der Arzneimitteleinsätze durch Bakteriophagen (Akronym: MideAPhage)
Das Projektvorhaben MideAPhage zielt darauf ab, ein innovatives, produktionsstufenübergreifendes Bakteriophagenprodukt zu entwickeln, welches der Prävention des Auftretens von pathogenen und zoonotischen Enterokokken in der Geflügelhaltung dient. Bakteriophagen (Phagen) stellen eine ressourcenschonende und natürliche Alternative zur Behandlung mit Antibiotika dar und ihre antibakterielle Wirkung wurde im Labormaßstab bereits gezeigt. Phagen sind im biologischen Sinne Viren und die natürlichen Feinde der Bakterien. Dabei ist ihre Wirkungsweise sehr spezifisch auf bestimmte Bakterienspezies oder -stämme gerichtet und verursacht weder eine Schädigung der gesamten natürlichen Mikrobiota noch eine Entstehung von Resistenzen in dieser. Das in diesem Projektvorhaben zu entwickelnde Phagenprodukt soll die frühe Besiedlung der Tiere mit Enterokokken reduzieren, damit später auftretende klinische Erkrankungen reduziert werden. Auf diese Weise soll die Geflügelgesundheit gefördert und die Anwendung von Antibiotika minimiert werden.
Projektverantwortliche:
LMQS (Koordinator): Dr. Sophie Kittler, Dr. Elisa Peh, Prof. Dr. Madeleine Plötz
Tierernährung: Prof. Dr. Christian Visscher, Prof. Dr. Julia Hankel
ITTN: PD Dr. Jochen Schulz, Prof. Dr. Nicole Kemper
WING (für Transfer): Prof. Dr. Nicole Kemper, Prof. Dr. Christian Visscher
Laufzeit:
Februar 2023 bis Januar 2026
Tierindividuelle Förderung der Kälbergesundheit durch Nutzung spezifischer Kolostrumadditive und phytogener Substanzen

Tierindividuelle Förderung der Kälbergesundheit durch Nutzung spezifischer Kolostrumadditive und phytogener Substanzen (CalPhy)
Ziel des Projektes "CalPhy" ist es, das Auftreten von behandlungsbedürftigen Erkrankungen in der Kälberhaltung zu reduzieren und damit erhöhten Verlusten entgegen zu wirken. Durch den Einsatz von hochwertigen Ergänzungen soll insgesamt die Versorgung der Kälber verbessert und damit die Tiergesundheit, das Tierwohl und die Leistung gefördert werden. Gezielt soll für die besonders empfindlichen Tiere innerhalb der Tiergruppen ein teil-individualisiertes Fütterungskonzept für die Praxis entwickelt werden. Leichte und in Teilen auch in gut geführten Beständen durch unvermeidbare Situationen (mechanische Geburtsprobleme etc.) geschwächte Neugeborene, sind besonders betroffen von einer ungenügenden Kolostrumversorgung. Diese Kälber benötigen zusätzlichen Schutz, damit die Gefahr eines überdurchschnittlichen Abfalls des kolostralen Immunschutzes nicht die Infektionsanfälligkeit erhöht. Um das Risiko von Erkrankungen auf das unvermeidbare Minimum zu reduzieren, sind auf Basis einer sensiblen Erfassung von ersten Krankheitsanzeichen bzw. prädisponierenden Situationen weitere Maßnahmen sinnvoll. Futtermittelzusatzstoffe können zur Stärkung von Kälbern und damit Förderung ihrer Gesundheit eingesetzt werden. Insbesondere phytogene Zusatzstoffe haben in gut geführten Betrieben das Potential, die Notwendigkeit für antibiotische Behandlungen weiter zu reduzieren. Durch die Reduzierung der Häufigkeit von Erkrankungen in der Kälberaufzucht sowie damit verbunden eine Steigerung der Tiergesundheit und des Tierwohls, kann das Projekt einen substantiellen Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Agrarwirtschaft bei bestmöglicher Förderung des Tierschutzes in der Landwirtschaft leisten.
Projektverantwortliche:
Prof. Dr. C. Visscher; Dr. C. Hartung
Laufzeit:
September 2023 bis August 2026
Drittmittelprojekt, gefördert durch Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit insgesamt 365.439 € (TiHo-Anteil)
Einsatz alternativer Proteinquellen in der Fütterung von Hunden

Einsatz alternativer Proteinquellen in der Fütterung von Hunden – Effekte auf die Akzeptanz, Verträglichkeit und Verdaulichkeit
Der Großteil des ökologischen Fußabdrucks, den ein Hund während seines Lebens verursacht, wird über die Hundenahrung produziert. Darüber sind sich auch immer mehr hundehaltende Personen bewusst. Die Zahl der vegan oder vegetarisch lebenden Menschen nimmt in den letzten Jahren stetig zu. Die Trends in der Hundeernährung entwickeln sich häufig parallel zu den Trends in der humanen Ernährung. Durch den Einsatz von pflanzlichen Nebenprodukten in der Hundeernährung kann der ökologischen Fußabdruck des Hundefutters reduziert werden. Hierfür sind Kenntnisse über die Verdaulichkeit und Akzeptanz dieser Nebenprodukte notwendig, um eine Verwendung von pflanzlichen Nebenprodukten im Hundefutter realisieren zu können. In diesem Projekt soll die Akzeptanz und Verdaulichkeit von pflanzlichen Nebenprodukten als Proteinquelle untersucht werden. Zusätzlich dazu wird eine großflächig angelegte Umfrage durchgeführt, die die aktuelle Verwendung von alternativen Proteinquellen und das Interesse der Hundehaltenden am Einsatz alternativer Proteinquellen im Hundefutter erfasst.
Projektverantwortliche:
Prof. Dr. C. Visscher, Dr. Cristina Ullrich, Dr. Volker Wilke, Prof. Dr. J. Hankel
Laufzeit:
September 2022 bis laufend




