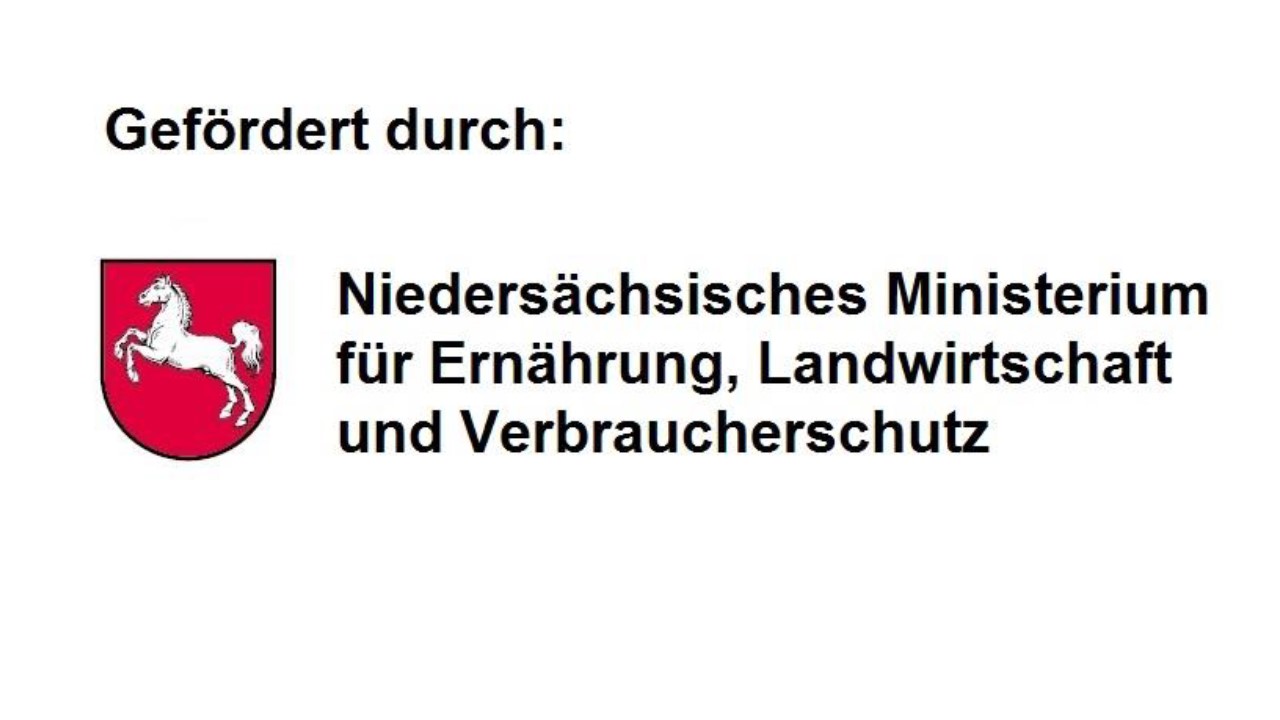
Kontakt:
Hintergrund
Die überwiegende Anzahl von den in Deutschland gehaltenen ca. 45 Millionen Legehennen wird in Volierensystemen untergebracht. In diesen mehretagigen Systemen können sich die Legehennen auf verschiedenen Ebenen frei bewegen und es werden ihnen dort Futter- und Wasser, Gruppennester sowie Sitzstangen zum nächtlichen Ruhen angeboten. Diese Art der Haltung ist für das Tierwohl von Vorteil, macht jedoch das Ausstallen der Tiere anspruchsvoll. So werden die Althennen mit einem Alter von mittlerweile 100 Wochen und mehr ausgestallt und in spezialisierten Schlachtbetrieben geschlachtet. Das Ausstallen erfolgt üblicherweise während der Dunkelphase (nachts), wenn die Tiere sich in das Volierensystem zum Schlafen zurückgezogen haben und die Tiere aufgrund der Dunkelheit beim Fangen ruhiger sind. Der Großteil der Tiere sitzt dann auf den Sitzstangen in der oberen, aber auch der mittleren Etage des Volierensystems.
Die Althennen werden üblicherweise aus dem Volierensystem an den Beinen (Ständern) gegriffen (4-5 Tiere/Person), kopfüber hochgehoben und anschließend in Transportbehältnisse (Kisten/Container) verladen. Diese Arbeit übernimmt hierfür speziell eingewiesenes, sachkundiges Personal, was als „Fängerkolonne“ vom Tierhalter beauftragt wird. Bei dieser praxisüblichen Art des Fangens und Verladens besteht die Gefahr von Fang- und Verladeschäden. Das Drehen von der aufrechten in die Kopfüber-Haltung ist für die Tiere mit Stress und wahrscheinlich Schmerz verbunden. Oft flattern und vokalisieren sie während dieser Bewegung. Eine wissenschaftliche Quantifizierung und Belastungseinschätzung der durch die genannte Fangmethode ausgelösten Stressreaktion steht allerdings noch aus.
Daher wird die zurzeit praktizierte Art des Fangens und Verladens aktuell aus Sicht des Tierschutzes stark diskutiert und es wird nach alternativen, tierschonenden Fangmethoden und –prozessen gesucht. Das gibt Anlass, Möglichkeiten aufzuzeigen und zu evaluieren, wie eine tierschutzgerechte Ausstallung und Verladung von Legehennen ermöglicht werden kann.
Ziel
Ziel dieses Vorhabens ist es, die praktische Umsetzbarkeit des tierschonenden Fangens und Verladens tierschutzfachlich, unter Berücksichtigung von Aspekten der Arbeitsbelastung und Ökonomie, einzuordnen und zu bewerten.
Anhand der Ergebnisse und praktischen Erfahrungen sollen weitere Optimierungsmaßnahmen (baulich/Management) abgeleitet werden, um den Fang- und Verladeprozess weiter zu verbessern.
Vorgehensweise und Methodik
Das Projekt startet am 1.10.2205 und gliedert sich in zwei Teilprojekte, die innerhalb von 18 Monaten bearbeitet werden.
In Teilprojekt 1 wird auf Praxisbetrieben geprüft, welchen Einflüsse das aufrechte Fangen mit umgreifen des Körpers bzw. greifen an beiden Ständern mit Brustbeinunterstützung in schwer zugänglichen Bereichen der Voliere, auf das Tierwohl (u.a. Tierverhalten, Verletzungen), die Verladezeit, die Arbeitsbelastung des Fängerpersonals sowie die Ökonomie hat.
Dazu werden insgesamt 20 Ausstallungen, jeweils 10 weiß befiederte und 10 braun befiederte Herden, begleitet. Je Herde sollen etwa 6.000 Tiere tierschonend von einem vorab geschulten Fängerteam tierschonend gefangen und verladen werden. Als Vergleich zum tierschonenden Fangen sollen Daten des herkömmlichen Fangens und Verladens der übrigen Herde herangezogen werden. Auf Grundlage der Ergebnisse und Erfahrungen sollen Empfehlungen und Optimierungsmöglichkeiten zum aufrechten Fangen erarbeitet werden.
Um belastbare Daten zur möglichen Stressbelastung des Fangens zu bekommen, werden in ein einem zweiten Teilprojekt unter experimentellen Bedingungen bei weiß- und braun befiederten Althennen beide Fangmethoden miteinander verglichen. indem anhand der Messung von Corticosteron-Metaboliten im Kot die Stressbelastung quantitativ erfasst wird.
Veröffentlichungen
Die Ergebnisse werden gegen Ende der Projektlaufzeit in Fachzeitschriften, auf nationalen Fachtagungen sowie auf der Homepage der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover veröffentlicht.
Projektpartner:
- Koordinator: Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie - Universität Osnabrück
Fachbereich Biologie/Chemie
Abteilung Verhaltensbiologie





