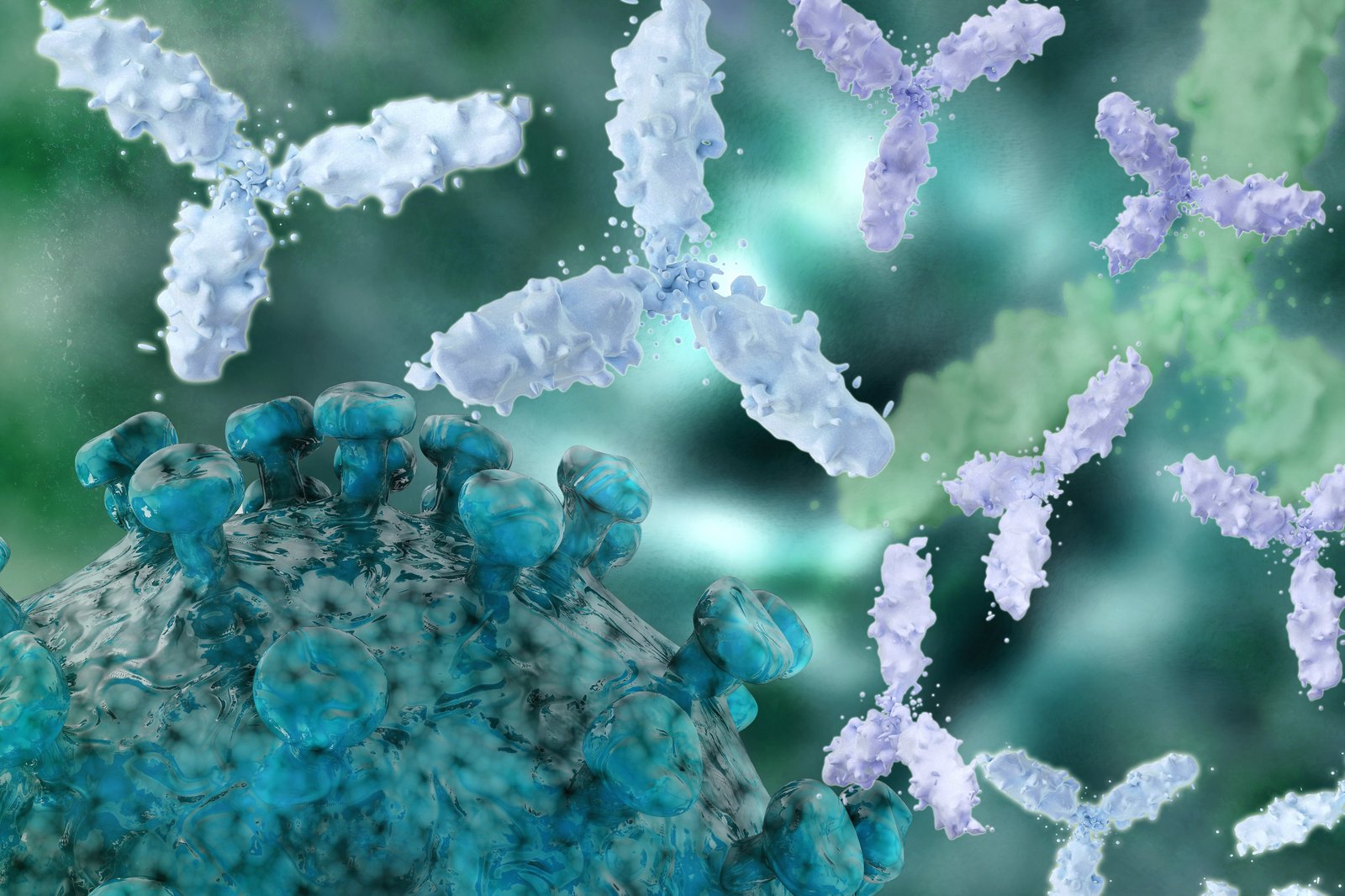Schnelle Erfolge
COFONI-Technologieplattform
Die zentrale Technologieplattform unterteilt sich in die Bereiche Tiermodelle und Testsysteme sowie Biobanken und Forschungsdatenbanken. Professorin Dr. Maren von Köckritz-Blickwede, Institut für Biochemie und RIZ, erklärt: „Das Forschungsnetzwerk generiert eine unglaubliche Menge wertvoller Proben, unter anderem an Tiermodellen. Wir wollen diese Daten sammeln und in einer Biobank allen Kooperationspartnern zur Verfügung stellen. So nutzen wir die Proben bestmöglich und können zusätzliche Tierversuche vermeiden.“ Zusammen mit Professorin Dr. Asisa Volz, Institut für Virologie und RIZ, Professor Dr. Lothar Kreienbrock, Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung, sowie mit Forschenden der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und des Universitätsklinikums Göttingen werden sie zudem zentrale Strukturen entwickeln, in der die Meta-Informationen und Untersuchungsergebnisse zu den gesammelten Proben strukturiert werden. Diese Informationen sollen alle COFONI-Forschenden für ihre Arbeiten nutzen können.
Antigene Kartographie
Eine zentrale Frage in der Corona-Forschung ist, wie wir den Schutz vor zukünftigen Virusvarianten verbessern können. „Einige Virusvarianten werden, je nachdem wie besorgniserregend sie sind, direkte Auswirkungen auf künftige COVID-19-Impfstrategien haben. Darum werden wir eine sogenannte antigene Kartographie erstellen. Sie bildet ab, wie sich SARS-CoV-2 verändert“, berichtet Virologe Professor Albert Osterhaus, PhD, aus dem RIZ, der das Projekt gemeinsam mit Dr. Imke Steffen, Institut für Biochemie und RIZ, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Primatenzentrum Göttingen leitet. „Basierend auf Blutproben aus verschiedenen Kontinenten erstellen wir eine geographische Kartierung der SARS-CoV-2-Antigene. Das gibt uns einen Überblick, wie die Antigene weltweit verteilt sind und wie stark sie sich voneinander und von den Antigenen, auf die die Impfstoffe zielen, unterscheiden. Die Kartierung liefert uns folglich Anhaltspunkte, wie künftige Impfstoffe aufgebaut sein müssen“, so Osterhaus.
Monoklonale Antikörper
„Effektive Impfstoffe stellen den schnellsten und langfristig erfolgreichsten Weg aus der Pandemie dar. Doch wir müssen auch an Therapeutika für den akuten klinischen Einsatz arbeiten. Deshalb werden wir in einem weiteren Fast-Track-Projekt gemeinsam mit dem Twincore humane monoklonale Antikörper im Hamstermodell testen“, erklärt Osterhaus. In einem Folgeprojekt wollen die Forschenden geeignete Antikörperkandidaten dann in klinischen Studien auf ihre Wirksamkeit und ihre Verträglichkeit untersuchen. Die monoklonalen Antikörper stehen bereits zur Verfügung. Die Forschenden konnten in der Zellkultur bereits zeigen, dass sie SARS-CoV-2 neutralisieren. Sie binden an das Spike-Protein auf der Oberfläche des Coronavirus. Auf diese Weise blockieren sie die Bindung von SARS-CoV-2 an die Rezeptoren auf der Oberfläche menschlicher Zellen. In der Folge können die Viren nicht in die Zellen eindringen und sie infizieren.
Die Suche nach Wirkstoffkandidaten
Um Mechanismen der SARS-CoV-2-Infektion besser zu verstehen und Wirkstoffkandidaten zu screenen, sind vorab umfangreiche Zellkulturversuche notwendig. Die in der Wissenschaft verbreiteten humanen Zellkulturmodelle, die für Infektionsuntersuchungen respiratorischer Viren genutzt werden, bilden vorwiegend den physiologischen Phänotyp von Lungenepithelzellen aus den oberen Atemwegen nach. „Zusammen mit Professor Dr. Ulrich Martin und Dr. Ruth Olmer aus der MHH erstellen wir deshalb ein physiologisches In-vitro-Modell aus Alveolar-Epithelzellen der unteren Atemwege“, erklärt Professorin Dr. Gisa Gerold aus dem Institut für Biochemie und dem RIZ. Alveolare Epithelzellen können aus Lungenexplantaten isoliert werden und in sogenannten Air-Liquid Interface Cultures ausreifen. „Die ausgereiften dis-talen Lungenepithelzellen infizieren wir zunächst mit klinischen Isolaten von SARS-CoV-2, um zu analysieren, welcher Zelltyp in den Air-Liquid Interface Cultures primär infiziert wird. Ein longitudinales Monitoring der Coronavirusinfektion in der Zellkultur wird uns zudem Erkenntnisse über Infektionsvorgänge in distalen Lungenabschnitten geben.“
Therapie mit Proteinkinasehemmern
Den dringenden Bedarf, effektive Therapeutika für COVID-19-Patienten zu entwickeln, betonen auch die beiden Virologen Husni Elbahesh, PhD, und Professor Guus Rimmelzwaan, PhD, aus dem RIZ. „Für schwere Influenza-A-Virus-Infektionen konnten wir bereits nachweisen, dass Proteinkinasehemmer vielversprechende Therapeutika sind. Deshalb verfolgen wir diese Strategie auch in unserem aktuellen Kooperationsprojekt mit der MHH. Um die Wirkung der Proteinkinasehemmer auf eine COVID-19-Erkrankung untersuchen zu können, validieren wir ein Ex-vivo-Infektionssystem, für das wir humane Präzisionsschnitte der Lunge verwenden.“ Bei diesen Lungenschnitten handelt es sich um lebende, dreidimensionale Gewebeschnitte mit vollständig aktiven Lungenzellen. In Vorarbeiten konnte das Forschungsteam bereits sechs antiviral wirkende Proteinkinasehemmer identifizieren, die sie jetzt in dem Ex-vivo-Infektionssystem testen. Um erfolgsversprechende Kandidaten auszuwählen, vergleichen sie die antivirale Effektivität und die Spezifität der Proteinkinasehemmer für SARS-CoV-2. Proteinkinasehemmer hemmen Proteinkinasen, indem sie dem Protein einen Phosphatrest hinzufügen.
Thromboserisiko bei COVID-19-Erkrankten
Schon früh in der SARS-CoV-2-Pandemie wurde deutlich, dass COVID-19-Patienten ein höheres Risiko für thrombotische Komplikationen im Gehirn und Schlaganfälle haben. Auch nach Impfungen traten entsprechende Komplikationen auf. Privatdozentin Nicole de Buhr, PhD, aus dem Institut für Biochemie und dem RIZ, geht in einem Kooperationsprojekt mit der MHH den Ursachsen für dieses erhöhte Thromboserisiko auf den Grund: Das Forschungsteam untersucht Blutproben und Thromben von Schlaganfallerkrankten auf spezifische Marker für sogenannte Neutrophil Extracellular Traps (NETs). NETs sind netzartige Strukturen aus DNA und Proteinen, die von den Neutrophilen Granulozyten freigesetzt werden, um Krankheitserreger unschädlich zu machen. Sie sind Teil der angeborenen Immunantwort und können bei einer überschießenden Immunantwort oder Fehlregulation Thrombosen und somit Schlaganfälle auslösen. „Die erhobenen Messwerte korrelieren wir mit klinischen Parametern. So können wir verschiedene Kohortengruppen vergleichen. Die Studie soll helfen, die Pathogenese von Schlaganfällen bei COVID-19-Patienten und bei Impfkomplikation besser zu verstehen“, so de Buhr.
Der Geruch der Infektion
Bereits veröffentlicht sind die Arbeiten eines Fast-Track-Projekts, in dem Forschende unter der Leitung von Professor Holger Volk, PhD, Klinik für Kleintiere, zeigten, das Corona-Spürhunde SARS-CoV-2 am Geruch von 15 anderen Atem-wegsviren unterscheiden können. Im November veröffentlichten sie die Studie in der Fachzeitschrift Frontiers in Medicine. Die Hunde riechen nicht die Viren selbst, sondern flüchtige organische Verbindungen, die bei Stoffwechselvorgängen nach einer Virusinfektion entstehen. Für die Studie trainierten die Forschenden die Spürhunde mit inaktivierten Speichelproben von SARS-CoV-2-Patienten. Die Tiere unterschieden mit einer mittleren Sensitivität von 74 Prozent und einer Spezifität von 95 Prozent zwischen SARS-CoV-2 und Abstrichproben von Patienten, die mit anderen Atemwegsviren infiziert waren. Die Sensitivität bezieht sich auf den Nachweis positiver, die Spezifität auf den Nachweis negativer Kontrollproben. Da nicht alle Virusproben ohne Weiteres von infizierten Personen verfügbar waren, verwendete das Forschungsteam auch Viren in Zellkulturen. Hier zeigten die Hunde ähnlich gute Ergebnisse, wenn sie zuvor auch mit inaktiviertem Zellkulturmaterial von SARS-CoV-2 trainiert wurden. Wurden sie mit inaktivierten SARS-CoV-2-Speichelproben trainiert, war ihre Trefferquote, wenn ihnen Zellkulturmaterial präsentiert wurde, schlechter.