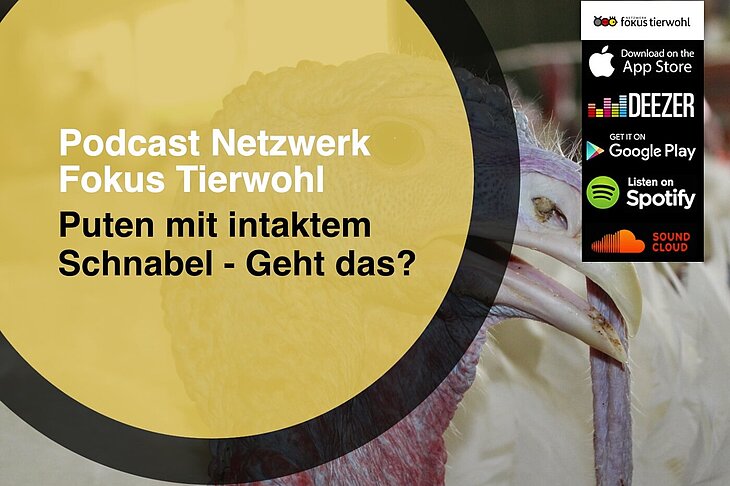Das Netzwerk Fokus Tierwohl ist ein Verbundprojekt, koordiniert vom Verband der Landwirtschaftskammern. Zu den Projektpartnern gehören die Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen der Bundesländer, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG). Im Netzwerk wird Wissen zu Tierwohlfragen gesammelt, fachlich eingeordnet und für die Praxis aufgearbeitet.
Federpicken und Kannibalismus bei Puten
Puten haben eine ausgeprägte Neigung zum Picken. Die Pickaktivität und das enorme Erkundungsverhalten können dazu führen, dass die Tiere nicht nur ihre Umgebung mit dem Schnabel erforschen, sondern auch ihre Artgenossen picken. Wunden mit blutigen Stellen an befiederten und unbefiederten Körperregionen sind mögliche Folgen, was wiederum ein Anreiz für andere Tiere zum Weiterpicken darstellt. Bei den Hähnen kommen während der Geschlechtsreife Rangordnungskämpfe mit Verletzungsfolgen hinzu. Die Haltungsbedingungen müssen deshalb so gestaltet werden, dass dieses Verhalten berücksichtigt wird und Verhaltensstörungen vermieden werden. Pickverletzungen und ihre Folgen sollen durch das Kürzen der Schnabelspitzen bei den Eintagsküken vermieden werden. Eine seit vielen Jahren gängige Praxis. Der Eingriff gilt aber als Amputation im Sinne des Tierschutzgesetzes und ist nur mit Ausnahme möglich.
Puten mit intaktem Schnabel – wie geht das?
Die Arbeitsgruppe Puten des Tierschutzplans Niedersachsen beschäftigt sich bereits seit 2011 mit dem Ausstieg aus dem Schnabelkürzen. Zahlreiche wissenschaftliche Projekte zur Ursachsenfindung von Federpicken und Kannibalismus, zu Präventionsmaßnahmen sowie Praxisversuche wurden bereits durchgeführt. Trotzdem ist der Erfolg aufgrund der vielschichtigen Auslöser und Ursachen nur mäßig, so dass sich der Kupierverzicht für die Tiere nicht flächendeckend realisieren lässt, ohne dass es in der Haltung zu tierschutzrelevanten Problemen kommt. Im Podcast sprechen Susanne Gäckler (DLG) und Dr. Christian Lambertz (FiBL) über die Ursachen und Hintergründe der Pickproblematik mit Dr. Birgit Spindler von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Dr. Ronald Günther, Fachtierarzt für Wirtschaftsgeflügel und Berater, und dem Praktiker Henning Schweinebraden. Die Experten erläutern welche Maßnahmen das Risiko des Federpickens verringern helfen, in welchen Phasen der Aufzucht und Mast Kannibalismus vermehrt zu beobachten ist, oder was im Notfall hilft, wenn die Standardmaßnahmen nicht greifen. „Leider reicht es nicht aus, an einer Stellschraube zu drehen, um die Picksituation zu entschärfen und Verhaltensstörungen zu minimieren. Da sich jede Herde individuell verhält und zudem die jeweiligen Phasen der Aufzucht und Mast die Aktivität des Federpickens beeinflussen, müssen wir stets eine Vielzahl von Ansätzen in Betracht ziehen, Maßnahmen flexibel umsetzen und stetig anpassen, um das allgemeine Pickrisiko zu minimieren“, erläutert Dr. Birgit Spindler. „In der Praxis bewährt haben sich strukturierte Stallbedingungen wie Beschattungsmöglichkeiten, Unterschlupfmöglichkeiten, Wasserzusätze, Futter- und Einstreuvariationen, attraktives Spielmaterial und konsequentes Aussortieren angepickter Tiere in gesonderte Abteile“, so Spindler. In Extremsituationen hilft aber nur die zeitweilige Abdunkelung der Ställe, um die Situation zu beruhigen. Einig war sich die Expertenrunde darin, dass es bei der Haltung von Puten mit intakten Schnäbeln das A und O ist, schon bei den ersten Anzeichen von Federpicken zu reagieren und bepickte Tiere aus der Herde zu nehmen. Wichtig ist es, die Phasen zu kennen, in denen Federpicken und Kannibalismus vermehrt auftreten und das Verhalten der Tiere engmaschig zu kontrollieren. Da diese individuellen Maßnahmenpakete in der Praxis in der erforderlichen Flexibilität kaum umzusetzen sind, setzt die Wissenschaft verstärkt auf Digitalisierung in Tierstallungen. Mit kamerabasierten Systemen können Veränderungen im Stall und Verhaltensänderungen der Tiere als Frühwarnsystem direkt Meldungen an die Tierhaltenden weitergegeben werden. Die zweite wissenschaftliche Schiene ist aktuell die Ursachenforschung. Warum kommt es eigentlich zu einem vermehrten Pickgeschehen? Was sind die Auslöser? „Je größer unser Erkenntnisgewinn bei den eigentlichen Auslösern ist, desto besser können wir Konzepte für praxistaugliche Maßnahmenpakete entwickeln“, so Spindler.
Der Podcast „Puten mit intaktem Schnabel – Geht das?“ ist unter https://fokus-tierwohl.de/de/mediathek/podcasts/podcast-kupierverzicht-puten sowie auf allen üblichen Podcast-Plattformen online abrufbar. Auf der Projektwebseite www.fokus-tierwohl.de sind auch die weiteren Podcast-Folgen des Netzwerks Fokus Tierwohl zu finden.
Hintergrund
Als Teil des Bundesprogramms Nutztierhaltung fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) den Aufbau des Netzwerkes Fokus Tierwohl. Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um schweine-, geflügel- und rinderhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen. Neueste Erkenntnisse aus der angewandten Forschung, der Praxis, den Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz und anderen Projekten werden durch die Tierwohl-Kompetenzzentren in Kooperation mit Expertinnen und Experten der Verbundpartner gesammelt und fachlich fundiert eingeordnet. Ausführliche Informationen sind unter www.fokus-tierwohl.de zu finden.
Im Projekt verantworten FiBL und DLG gemeinsam die methodisch-didaktische Aufbereitung von Informations- und Schulungsmaterialien sowie die redaktionelle Betreuung der projekteigenen Homepage.